Das Elektrogesetz in Deutschland (ElektroG) regelt das Inverkehrbringen, die Entsorgung und die Verwertung von Elektro- und Elektronikgeräten. Es steuert unter anderem auch, welche Geräte zu registrieren und zu kennzeichnen sind (etwa mit dem allgegenwärtigen Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“). Doch was fällt nach dem Elektrogesetz Deutschland alles unter die Definition eines Elektrogerätes? Einfach gesagt: ein Elektrogerät ist ein Gerät, das einen elektrischen Strom oder ein elektrisches Feld für seinen ordnungsgemäßen Betrieb benötigt.
Zur Registrierung im Sinne des Elektrogesetzes in Deutschlandverpflichtet sind Hersteller, Vertreiber, Importeure und Direktversender. Wird, auch unwissentlich, ein nicht registriertes oder fehlerhaft registriertes Elektrogerät angeboten, stellt dies gemäß ElektroG eine Ordnungswidrigkeit dar. Damit gelten auch die entsprechenden Pflichten und Risiken sowohl für den Bereich der wettbewerbsrechtlichen Inanspruchnahme (Abmahnung) als auch für den öffentlich-rechtlichen Verantwortungsbereich.
Das Elektrogesetz in Deutschland setzt die europäische WEEE-Richtlinie um. Es regelt somit das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Wie auch die WEEE-Richtlinie hat das Elektrogesetz Deutschland die Abfallvermeidung und das Stärken der Wiederverwertung zum Ziel. Darüber hinaus soll das ElektroG Hersteller von Elektrogeräten in die Verantwortung nehmen. Der vollständige Name des Elektrogesetz in Deutschland lautet: Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Seltener wird es auch als Elektronikgerätegesetz, Elektronikgesetz oder Elektronikschrottverordnung bezeichnet.
Elektrogesetz Deutschland – ElektroG2
Grundsätzlich werden die Begriffe ElektroG2 und ElektroG sowie Elektrogesetz 2 und Elektrogesetz in Deutschland synonym verwendet. Streng genommen handelt es sich bei dem ElektroG2 um eine Novellierung des ursprünglichen Elektrogesetz, die stufenweise von 2014 bis 2018 in Kraft trat. Das ElektroG2 wiederum basiert auf der Novellierung der ursprünglichen WEEE-Richtlinie 2002/96/EG, also auf der neueren WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, auch WEEE2 genannt.
Elektrogesetz Deutschland: Das Elektrogesetz 3
Die Bundesregierung hat nun die nächste Novellierung des Elektrogesetzes in Deutschland für Elektro- und Elektronikaltgeräte verabschiedet. Das neue Elektrogesetz 3 ist am 01. Januar 2022 in Kraft getreten und geht, anders als seine Vorgänger, nicht auf eine Aktualisierung der WEEE-Richtlinie zurück, sondern resultiert aus einer rein nationalen Gesetzesinitiative. Das neue Elektrogesetz in Deutschland beinhaltet so vor allem neue Haftungen für Marktplatzbetreiber und Fulfillment-Dienstleister sowie abgeänderte Rücknahmepflichten im Handel. Auch die Herstellerpflichten wurden in dem ElektroG3 nochmal erweitert.
Elektrogesetz 2023 – Das ändert sich in diesem Jahr
Das Elektrogesetz wurde auch in diesem Jahr novelliert. Damit Sie trotz der Änderung des Elektrogesetzes rechtssicher agieren können, haben wir die wesentlichen Änderungen für Sie auf einen Blick festgehalten:
- Ab dem 01.01.2023 müssen auch B2B-Geräte mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne nach DIN EN 50419 gekennzeichnet werden. Nach Inkrafttreten des ElektroG3 im Januar 2022 gab es eine einjährige Übergangsfrist. Es gelten die gleichen Regeln, die seit 2005 für B2C-Geräte gelten. Der Mülleimer sollte dauerhaft und direkt am Produkt erkennbar sein, es sei denn, seine Größe oder Funktion verhindert dies (in diesem Fall kann er auch in der Bedienungsanleitung, Verpackung oder Garantie erwähnt werden).
- Ebenfalls seit Januar dieses Jahres müssen Bevollmächtigte ausländischer Hersteller mit mehr als 20 aktiven Registrierungen zunächst von der Stiftung EAR akkreditiert werden. Dabei werden verschiedene Kriterien wie Zuverlässigkeit, personelle und finanzielle Ressourcen sowie Kompetenz geprüft.
- Darüber hinaus erhebt die Stiftung EAR seit Beginn des Jahres von allen registrierten Herstellern, einschließlich vertretungsberechtigter ausländischer Unternehmen, eine neue reguläre Quartalsgebühr von ca. 25 €.
- Mit Wirkung zum 1. Juli 2023 haben elektronische Marktplätze und Fulfillment-Dienstleister ihre Sorgfaltspflichten für Händler und Kunden zur Einhaltung des ElektroG erweitert. Kann die erforderliche Registrierung nicht nachgewiesen werden, muss der betreffende Akteur gesperrt werden. Möglicherweise können wir das betreffende Produkt nicht liefern. In letzter Minute Ende 2022 wurde diese Frist um sechs Monate von Januar bis Juli 2023 verlängert.

Elektrogesetz Feststellungsantrag
Grundsätzlich sind Sie als Hersteller dafür verantwortlich, das Elektrogerät, welches Sie auf den Markt bringen möchten, auf rechtliche Vorgaben zu prüfen. Dies kann gerade für Laien jedoch äußerst schwierig sein. Daher kann nun im Zweifelsfall eine verbindliche kostenpflichtige Bescheinigung über die Meldepflicht bei der Stiftung EAR angefordert werden (Elektrogesetz Feststellungsantrag).
Bevollmächtigte von Herstellern/ElektroG können nach Anlegen eines Bewerberkontos auf dem EAR Portal Anträge zur juristischen Einschätzung stellen. Ein Bevollmächtigter des Herstellers muss die Gründe für die Prüfung des Verdachtsfalls kurz darlegen und begründen sowie das elektrische Betriebsmittel, insbesondere dessen Einsatzgebiete und Funktion, detailliert beschreiben.
Gemäß des neuen Zulassungsprozesses für Bevollmächtigte mit mehr als 20 Registrierungen fällt eine entsprechende Elektrogesetz Zulassungsgebühr in Höhe von etwa 1200 € an. Diese wird bei der Erstregistrierung erhoben und danach immer pro Änderung, jedoch nicht jährlich.
Elektro- und Elektronikaltgeräte im Sinne des Elektrogesetz Deutschland
Gemäß § 3 Elektrogesetz Deutschland sind Elektro- oder Elektronikgeräte Geräte, die für den Betrieb mit Wechselspannung von höchstens 1.000 Volt oder Gleichspannung von höchstens 1.500 Volt ausgelegt sind und …
- zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb von elektrischen Strömen oder elektromagnetischen Feldern abhängig sind, …
- oder der Erzeugung, Übertragung und Messung von elektrischen Strömen und elektromagnetischen Feldern dienen.
Elektrogesetz Deutschland Ausnahmen: Passive Geräte
2019 gab es eine Änderung am Elektrogesetz in Deutschland, durch die viele Geräte in den Geltungsbereich des Elektrogesetzes fallen, die vorher nicht betroffen waren: passive Geräte. Seit dieser Änderung gilt grundsätzlich jeder Artikel, der elektrische Energie nutzt, diese durchleitet oder misst, als Elektro- oder Elektronikgerät. Folglich fallen nicht nur Geräte wie Fernseher, Kühlschränke oder Mikrowellen unter diese Definition, sondern auch passive Geräte ohne eigene Stromversorgung, etwa USB-Sticks oder Lade- und Verbindungskabel. Dem liegt eine Änderung am Elektrogesetz in Deutschland zugrunde, die am 01.05.2019 wirksam wurde – seitdem schließt das Elektrogesetz passive Geräte ein.
Auch Produkte, die viele Menschen intuitiv nicht als Elektrogeräte einordnen würden, werden somit vom Elektrogesetz in Deutschland erfasst: So gelten die entsprechenden Pflichten und Auflagen etwa auch für batteriebetriebene Armbanduhren, Tresore mit elektronischem Schloss oder Möbel mit integrierter Beleuchtung.

Das Elektrogesetz bereitet Ihnen Kopfzerbrechen?
Es drohen erhebliche Abmahnungen und Bußgelder, auch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
Die Deutsche Recycling unterstützt Sie bei nationalen und internationalen Recycling-Gesetzgebungen, mit flexibel auf Ihre Produkte und Regionen zugeschnittenen Services mit Fokus auf Verpackung, Batterien und Elektrogeräte.
Elektrogesetz Deutschland – § 9 Kennzeichnungspflicht (WEEE-Kennzeichnung)
Gemäß § 9 des Elektrogesetzes in Deutschland müssen Inverkehrbringer die in Verkehr gebrachten Geräte besonders kennzeichnen. Umgangssprachlich werden die notwendigen Kennzeichnungen auch WEEE-Kennzeichnung genannt, in Anlehnung an die europäische WEEE-Richtlinie, auf der das Elektrogesetzt basiert.
Eine WEEE-Kennzeichnung beinhaltet unter anderem das Aufbringen des Geräteherstellernamens beziehungsweise des entsprechenden Markennamens, unter dem das Gerät bei der Stiftung ear registriert ist, auf dem jeweiligen Gerät. Produkte, die sich an Endverbraucher richten, sind zudem mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zu kennzeichnen. Dieses steht für den Hinweis, dass eine Entsorgung über den Hausmüll nicht zulässig ist. Hier kennt das Elektrogesetz in Deutschland Ausnahmen: In bestimmten Fällen kann das Symbol statt auf dem Gerät auf der Verpackung, der Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein aufgedruckt werden.

Bild: Gemäß Elektrogesetz gilt die Kennzeichnungspflicht (WEEE-Kennzeichnung) mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne für Produkte, die sich an Endverbraucher richten. © fotohansel/stock.adobe.com
Zusätzlich zur Kennzeichnungspflicht gemäß des Elektrogesetzes in Deutschland gilt für Inverkehrbringer die Informationspflicht gegenüber privaten Haushalten gemäß § 18 ElektroG. Diese sieht unter anderem vor, dass auf die Auswirkungen unsachgemäßer Entsorgung von Elektroaltgeräten hingewiesen, auf die Eigenverantwortung der Endnutzer bei der Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten informiert und die Bedeutung des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne erklärt wird. Es gelten, neben den genannten Punkten, weitere Informationspflichten gemäß § 18 Elektrogesetz und § 9 Elektrogesetz Deutschland weitere Kennzeichnungspflichten.
Elektrogesetz Deutschland – WEEE-Kennzeichnung im Ausland
Je nach Land, in dem Produkte in Verkehr gebracht werden, können unterschiedliche WEEE-Kennzeichnungen notwendig sein. Beispielsweise gilt in Frankreich seit 2021 die Pflicht, das sogenannte Triman-Logo auf Elektrogeräten oder dessen Verpackung anzubringen. Bezüglich der WEEE-Kennzeichnung im Ausland ist unbedingt zu beachten: Die jeweils landesspezifischen Regelungen gelten nicht nur für Unternehmen, die ihren Sitz im jeweiligen Land haben, sondern für alle, die Produkte dort auf den Markt beziehungsweise in Verkehr bringen. Demnach gilt die Pflicht zur WEEE-Kennzeichnung beispielsweise auch für Exporteure.
Sie haben Fragen zur Elektrogesetz-Kennzeichnungspflicht und dem Elektrogesetz in Deutschland? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – wir unterstützen Sie gerne!
Elektrogesetz Deutschland: Rücknahmepflicht für Elektroaltgeräte nach Elektrogerätegesetz
Für (Online-)Händler gilt unter Umständen gemäß Elektrogesetz in Deutschland eine Rücknahmepflicht: Entfallen mindestens 400 m² ihrer Versand-, Lager- und Verkaufsfläche in Deutschland pro Standort auf Elektro- und Elektronikgeräte, so müssen sie geeignete Rückgabemöglichkeiten für Elektroaltgeräte „in zumutbarer Entfernung zum Kunden“ schaffen. Die zurückgenommenen Altgeräte können gemäß Elektrogesetz Deutschland gesammelt und anschließend entweder an öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, Bevollmächtigte oder Rücknahmesysteme übergeben werden. Auch die Beauftragung eines zertifizierten Entsorgungsunternehmens ist möglich.
Dabei gilt gemäß Elektrogesetz in Deutschland: Rücknahme ist nur für Geräte zu leisten, die in privaten Haushalten genutzt werden können. Wird im Zuge der Rücknahme ein Gerät der gleichen Geräteart verkauft, so hat die Rücknahme unentgeltlich zu erfolgen (1:1-Rücknahme). Unabhängig vom Verkauf eines Elektrogeräts müssen Händler bis zu fünf Geräte pro Kunde unentgeltlich zurücknehmen (0:1-Rücknahme) – vorausgesetzt, dass keine der äußeren Abmessungen des Altgeräts eine Länge von 25 cm übersteigt. Für den Kunden muss die Rücknahme an sich kostenlos sein. Eventuell anfallende Versand- oder Abholungskosten, beispielsweise, wenn die Rückgabe an einen Online-Händler erfolgt, muss der Kunde selbst tragen.

Elektrogesetz in Deutschland – Rücknahmepflicht für Händler mit einer Versand-, Lager- oder Verkaufsfläche für Elektrogeräte von mind. 400 m². Bild: © Nomad_Soul/stock.adobe.com
Ihnen sitzt das Elektrogesetz im Nacken?
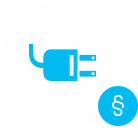

Bei uns erhalten Sie Beratung, Analyse und Umsetzung zum Elektrogesetz aus einer Hand.
Im Dschungel der Vorschriften zum Elektrogesetz/WEEE kann man sich leicht verlieren – mit schwerwiegenden finanziellen Folgen.
Die Deutsche Recycling übernimmt die Abwicklung sämtlicher damit verbundener Verpflichtungen und senkt dabei Aufwand und Kosten für Ihr Unternehmen, verhindert mögliche Strafen und Abmahnungen und reagiert auf die stetigen Veränderungen der Gesetzeslage. Unser Expertenteam freut sich darauf, Sie persönlich zu unterstützen.
Elektrogesetz Deutschland: B2B und B2C Kunden
Das Elektrogesetz in Deutschland unterscheidet zwischen Business-to-Business- (B2B) und Business-to-Consumer (B2C) Geräten. So gilt gemäß Elektrogesetz Deutschland: B2B-Geräte sind Elektro- und Elektronikgeräte, deren tatsächliche Verwendung ausdrücklich nicht in privaten Haushalten stattfindet oder die bestimmungsgemäß nicht in privaten Haushalten verwendet werden. Der Inverkehrbringer muss diese Umstände bei der Stellung des Registrierungsantrags glaubhaft machen.
Gelingt dies nicht, gelten diese Geräte gemäß Elektrogesetz in Deutschland nicht als B2B- sondern als B2C-Geräte. Anders als B2B-Geräte sind B2C-Geräte laut Elektrogesetz Deutschland solche, die in privaten Haushalten, etwa in der Wohnung oder im zugehörigen Garten, genutzt werden können. Somit ist nicht der Vertriebsweg entscheidend darüber, ob ein Gerät vor dem Elektrogesetz als B2B- oder B2C-Gerät eingestuft wird, sondern der Ort der ausschließlichen Nutzung.
Elektrogesetz Deutschland – Zusammenfassung
Verpflichtet sind laut Definition des Elektrogesetz in Deutschland alle, die gewerbsmäßig:
- Produkte unter eigenem Markennamen herstellen und erstmals in Deutschland in Verkehr bringen.
- Elektro- und Elektronikgeräte anderer Anbieter in eigenen Produkten und/oder unter dem eigenen Markennamen in Deutschland weiterverkaufen.
- Elektrogeräte erstmals in Deutschland einführen und in Verkehr bringen.
Was sind gemäß Elektrogesetz Deutschland die Konsequenzen bei einer Nichtlizenzierung?
Verstöße gegen die Registrierungspflicht und Rücknahmepflicht nach dem Elektrogesetz in Deutschland stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem sechsstelligen Betrag geahndet werden kann. Die Verpflichteten erhalten durch die Registrierung bei der Stiftung ear eine achtstellige WEEE-Nummer, die im täglichen Geschäftsverkehr analog zur UST-Nr. zu führen ist. Zusätzlich werden alle verpflichteten Unternehmen in einem öffentlichen einsehbaren Register geführt. Entsprechend hoch ist die Transparenz für Dritte und das Folgerisiko. Eine Falsch- oder Nichtregistrierung gemäß des Elektrogesetzes in Deutschland ist eine Ordnungswidrigkeit und wird außerdem als abmahnbarer Wettbewerbsverstoß eingestuft. Dies hat den gewünschten Effekt, dass sich der Markt selbst reguliert.
Die Verpflichteten erhalten durch die ear-Registrierung eine achtstellige WEEE-Nummer, die im täglichen Geschäftsverkehr analog zur UST-Nr. zu führen ist. Zusätzlich werden alle verpflichteten Unternehmen in einem öffentlichen einsehbaren Register geführt. Entsprechend hoch ist die Transparenz für Dritte und das Risiko auf eine Abmahnung nach dem Elektrogesetz. Dies hat den gewünschten Effekt, dass sich der Markt selbst reguliert.
Elektrogesetz Deutschland – Herstellerpflichten einfach sicherstellen
Jeder verpflichtete Hersteller, Vertreiber, Importeur und Direktversender muss nach dem Elektrogesetz in Deutschland eine Registrierung bei der zuständigen Behörde (Stiftung ear) vornehmen, bevor die entsprechenden Produkte in den Verkehr gebracht werden dürfen. Übrigens erfordert auch das bloße Anbieten von E-Geräten eine Registrierung. Die Registrierung nach dem Elektrogesetz in Deutschland ist als aufwendig zu bezeichnen. Grob gesagt müssen Hersteller die drei folgenden Schritte einleiten und beachten:
- Registrierung aller Marken/Gerätearten auf Basis von Jahresplanmengen – ab Freigabe und Erhalt der WEEE-Nummer monatliche IST-Mengen-Meldung sowie eine Jahresabschlussmeldung gemäß Elektrogesetz in Deutschland
- Hinterlegung von insolvenzsicheren Garantien mit Sicherheitsleistung der Rückgriffsansprüche der ear – die Höhe ist abhängig von Planmengen
- Sicherstellung der deutschlandweiten Entsorgung der Sammelbehälter für Elektroaltgeräte auf den Wertstoffhöfen. Den Herstellern werden Abholordnungen/Bereitstellungsanordnungen (Entsorgungsaufträge) in ganz Deutschland zugeteilt und diese müssen die Behälter innerhalb von
96 Stunden abholen lassen.
Genau in diesen Bereichen ist die Deutsche Recycling der richtige Ansprechpartner für Sie. Wir reduzieren Ihren Aufwand bei der Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Elektrogesetzes in Deutschland und übernehmen dabei zu 100% die Haftung. Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung und profitieren Sie von einem erheblichen Zeit- sowie Kostenvorteil.

Elektrogesetz in Deutschland ¬– Die Deutsche Recycling GmbH unterstützt bei sämtlichen gesetzlichen Regelungen
Die neue ElektroGBattGGebV 2023
Die neue ElektroGBattGGebV, also die Gebührenordnung zum Elektro- und Batteriegesetz ist Anfang 2023 in Kraft getreten und beinhaltet einige Neuerungen für Hersteller und Inverkehrbringer von Elektronik- sowie Elektrogeräten. Die wichtigsten Punkte haben wir im Folgenden für Sie zusammengefasst:
- Die Anmeldegebühr (ElektroG) halbiert sich auf 12,40 € je Neuanmeldung oder Abmeldung.
- Eine neu vierteljährliche Gebühr von 24,10 € pro Anmelder wurde bei der ElektroGBattGGebV eingeführt. Diese Gebühr fällt erstmals 2023 an und gilt sowohl für B2B-Hersteller als auch für B2C. Letzterem wird erst nach der Erstanmeldung die reguläre Folgegebühr in Rechnung gestellt. Diese Gebühr entfällt für BattG-registrierte Hersteller.
- Der Höchstaufwand für einen Feststellungstrag für das Elektrogesetz wird von über 3.000 Euro auf ein neues Maximum von etwa 2000 € reduziert.
- Die Gebühr für die Ernennung eines Bevollmächtigten wird in der neuen ElektroGBattGGebV um etwa das Vierfache erhöht. Dahingegen wird die Änderungspauschale halbiert.
- Neben dem neuen Vollmachtsverfahren für vertretungsberechtigte Personen mit mehr als 20 Registrierungen fällt eine entsprechende Vollmachtsgebühr (ElektroG) in Höhe von rund 1200 € an. Diese wird bei der Erstanmeldung und danach bei jeder Änderung erhoben, jedoch nicht jährlich (z. B. für Bürgen). Auch das Batteriegesetz verlangt keine Zustimmung eines Bevollmächtigten.
Insbesondere die neue vierteljährliche Zusatzgebühr dürfte für einigen Aufschrei sorgen. Vor allem die (sehr) kleinen Hersteller und diejenigen, die als erste B2B-Geräte auf den Markt bringen, werden besonders hart getroffen. Ein Härtefallantrag (nach Jahresumsatz) zur möglichen Befreiung von dieser Gebühr wurde nun aus der Gebührenverordnung gestrichen.
Rücknahme & Recycling im E-Commerce
Der Leitfaden für Onlinehändler
Der Onlinehandel boomt. Was gerade jetzt besonders wichtig ist: Wer mit Produkten handelt, unterliegt verbindlichen Entsorgungs- und Recycling-Pflichten, deren Nichterfüllung zu erheblichen Sanktionen und Abmahnungen führen kann wie bei dem Elektrogesetz in Deutschland. Das Problem: Viele Händler sind sich ihrer Verpflichtungen nicht bewusst. Doch nur wer rechtssicher handelt, ist vor ungeplanten Kosten und Bußgeldern sicher. Leitfaden herunterladen
Sie haben Fragen oder wünschen weitere Infos? Nehmen Sie schnell und einfach Kontakt mit uns auf.






